Gut ein Jahr ist es her, dass Modularbank seine Zelte auch in Deutschland aufgeschlagen hat. Modularbank ist ein erst 2019 gegründetes FinTech-Unternehmen aus Estland, das eine moderne und flexible Core-Banking-Plattform anbietet. Im Herbst letzten Jahres verkündeten die Esten ein Funding von vier Millionen Euro: Die Runde wurde von Karma Ventures und BlackFin Capital Partners angeführt und von Plug and Play Ventures (der Investor und „Accelerator“ aus dem Silicon Valley hält seit der Start-up-Phase auch Anteile an Unternehmen wie Paypal, Dropbox und Lendico), Siena Capital sowie Angel Investor Ott Kaukver, dem ehemaligen CTO von Twilio und Skype, begleitet. Modularbank verkauft Software an Fintechs und Banken und profitiert stark von der Digitalisierung der Branche.
Ganz alleine steht Modularbank mit seinem Angebot auf dem hiesigen Markt jedoch nicht. So entwickelte Mambu beispielsweise bereits die technische Infrastruktur für die Challengerbank N26. Hinzu kommt: Mambu stieg unlängst in die Riege der Einhörner auf. Zuletzt stieg Spotify-Investor TCV gemeinsam mit Tiger Global und Arena Holdings sowie den Altinvestoren Bessemer Venture Partners, Runa Capital und Acton Capital in das Berliner Unternehmen ein, dass damit mit 1,7 Milliarden Euro bewertet wird. Auch die Solarisbank ist in diesem Bereich sehr aktiv.
Die Zeichen stehen auf Wachstum
Davon aber lässt sich das Team um die erfahrene Gründerin Vilve Vene nicht abschrecken. Mehrere Kundengespräche seien sehr weit fortgeschritten und man habe gute Beziehungen zu verschiedenen Systemintegratoren sowie Partnerschaften mit anderen deutschen Dienstleistern und Fintechs aufgebaut, sagt sie.

Aktuell beschäftigt das Unternehmen 47 Leute, bis Ende 2021 soll diese Zahl auf 100 verdoppelt werden. Die Vertriebsaktivitäten werden auf die Schweiz, Österreich, Frankreich und Südeuropa ausgeweitet, die Präsenz in Großbritannien mit einem eigenen Büro in London soll gestärkt werden.
Frau Vene, Corona war ein Beschleuniger für Innovation und Integration neuer Systeme in die bestehende Bankenlandschaft – gerade in Deutschland. Glauben Sie, dass sich dieses Tempo fortsetzen wird?
Ich denke, die Pandemie hat Banken dazu gezwungen, genau zu verstehen, wie viel Arbeit sie bei der digitalen Transformation noch vor sich haben. Sie hat schmerzhaft deutlich gemacht, dass die aktuellen Prozesse in den Banken nicht mehr zeitgemäß sind. Gleichzeitig hat die Situation aber auch zu Veränderungen im Kundenverhalten geführt und die Nachfrage nach vollständig digitalen Bankdienstleistungen beschleunigt. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Banken- und Finanzbranche wandelt, wird meiner Meinung nach in den kommenden Jahren rasant wachsen. Wir haben gerade erst angefangen, diese Branche umfassend zu digitalisieren.
Speziell im Bereich des Core-Bankings wächst die Erkenntnis, dass der traditionelle „alles raus und neu“-Ansatz nicht funktioniert. Man kann nicht die gesamte Organisation auf einmal auf eine neue Core-Banking-Plattform migrieren. So etwas dauert Jahre und kostet viel Geld – beides passt nicht zur Geschwindigkeit, mit der sich Banken heutzutage bewegen müssen. Ich denke, die Verantwortlichen wissen nun endlich, dass ein schrittweiser, modularer Ansatz weitaus sinnvoller ist, als das Altsystem in einem Big Bang zu ersetzen, wie es die Apobank getan hat.
Was bedeutet es, eine Bank wirklich zu modernisieren?
Das ist eine große Frage! Die Modernisierung beginnt mit der Einsicht, dass sich die Welt verändert hat – und zwar viel schneller als die Banken selbst. Sie müssen nicht nur aufholen, sondern sich selbst so gestalten, dass sie die sich immer weiter entwickelnden und wachsenden Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden erfüllen. Dafür gilt es, im Kern zu beginnen und offen für andere Ökosystemteilnehmer auf dem Markt zu sein. Letzteres ist auch der Grund, warum der API-basierte Ansatz und Cloud Computing eine so wichtige Rolle bei der Modernisierung spielen. Außerdem müssen Banken verstehen, dass Technologie keine separate Funktion ist, sondern fester Bestandteil jeder Geschäftsfunktion.
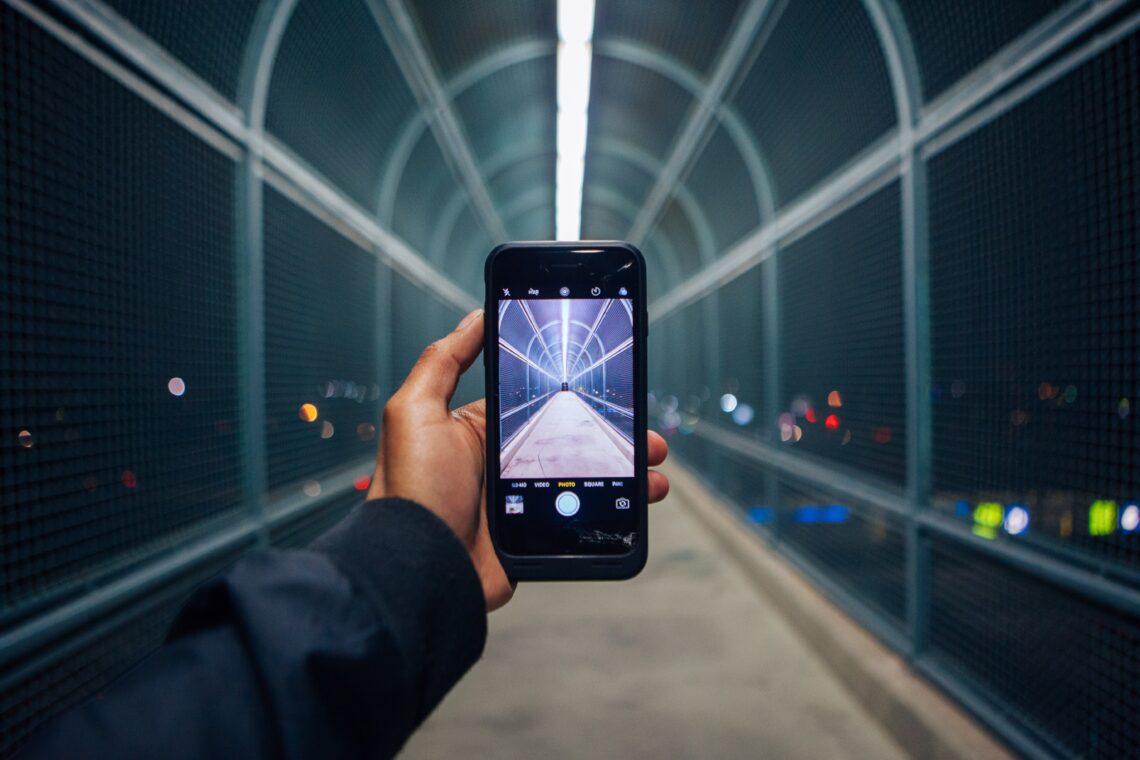
Deshalb ist Technologie aus meiner Sicht zwar zweifelsohne ein entscheidendes Element für die Modernisierung, aber durch sie allein wird eine Bank sich nicht differenzieren oder Kunden gewinnen können. Den Begriff „digitale“ Transformation finde ich irreführend, denn er impliziert, dass Wandel nur technologisch ist.
Das wird dem Ausmaß der langfristigen Veränderungen nicht gerecht, die bei der Umstellung eines gesamten Unternehmens auf ein digitales Modell erforderlich sind. Und er zeigt auch nicht, wie weit sich ein Unternehmen anpassen muss, um die Möglichkeiten eines digitalen Geschäftsmodells optimal zu nutzen.
Deshalb ist ein Transformationsprogramm meiner Meinung nach nur zu 20 Prozent technisch und zu 80 Prozent kulturell. Wenn wir über Technologie sprechen, dann ist die Technologie, die die Transformation ermöglicht, heute schon da. Was von den Banken neu überdacht werden muss, sind die Geschäftsprozesse, die sich von offline auf online verlagern, und das bringt eine lange, große Veränderung in der Struktur und im Verhalten der Organisationen mit sich.
Corona offenbart viele infrastrukturelle Probleme in Deutschland, z.B. Internet, Datentempo etc. Aus Ihrer Perspektive als Estin: Wird Deutschland seinen internationalen Anschluss verlieren? Wo liegt eine Chance?
Corona hat nicht nur in Deutschland die Schwachstellen aufgezeigt, sondern auf der ganzen Welt. Überall mussten Dienste ins Internet verlagert werden – von der Art und Weise, wie Menschen arbeiten und kommunizieren, bis hin dazu, wie sie Dienste nutzen und konsumieren.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland den internationalen Anschluss verliert. Vielmehr bin ich überzeugt davon, dass die Zukunft für Deutschland sehr rosig ist. Es ist jedoch richtig und wichtig, auf solche infrastrukturellen Herausforderungen hinzuweisen. Denn nur, wenn solche Themen beleuchtet werden, wird man erkennen, dass daran gearbeitet werden muss.
Was bedeutet das für Ihr Wachstum in diesem Land?
Die infrastrukturellen Internet-Probleme wirken sich natürlich auch auf den Betrieb von Banken aus. Diese Herausforderungen sind aber nicht nur technologisch bedingt, sondern haben viele Wurzeln, darunter auch die Telekommunikation, nationale Politik und föderale Strukturen. Aber ich denke, dass Deutschland die Ressourcen hat, an diesen Herausforderungen zu arbeiten, bevor das Wachstum der Unternehmen im Land wirklich behindert wird.
Sie sind auch dabei, ein Büro in Großbritannien zu eröffnen. Ist das heutzutage nicht zu riskant? Stichwort: Brexit!
Nein, eher im Gegenteil: Der Brexit macht eine Präsenz in Großbritannien für uns noch sinnvoller, denn wir machen uns dadurch weniger abhängig von etwaigen neuen Abkommen zwischen Großbritannien und der EU. Mit einer britischen Repräsentanz und lokalen Experten vor Ort können wir britischen Kunden bestmöglich helfen.

Darüber hinaus ist London der Fintech-Hub Europas und ich erwarte nicht, dass sich das ändert. Letztes Jahr zum Beispiel wurde ein Viertel aller VC-Investitionen in Europa von London vereinnahmt. Darüber hinaus verfügt Großbritannien über ein gut vernetztes Ökosystem aus Politik, Talenten und Nachfrage von Finanzinstitutionen – von Verbrauchern, Unternehmen, Finanzinstituten und Regierung gleichermaßen. Wir wollen also definitiv vor Ort sein.
Was sagen Sie zu der These, dass Banken keine Banken mehr sein werden? Was werden sie dann sein?
Banken werden Banken sein und bleiben. Verändern wird sich aber die Perspektive des Verbrauchers. In vielen Fällen wird die Bank für Kunden unsichtbar, wenn sie im Alltag verschiedene Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder sogar Kunden von Fintechs sind. Manche E-Wallets zum Beispiel laufen auf der Infrastruktur von Banken, aber der Endkunde sieht das nicht. Er interagiert immer noch mit der Bank, ohne es zu wissen. Das ist definitiv neu.




